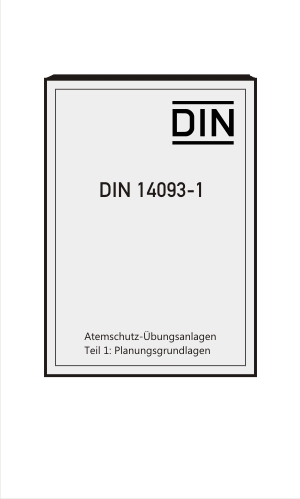Veränderungen:
- Prüfvorgaben für den Helm an die DIN EN 443 angepasst
- Begriffe überarbeitet
- zusätzliche, nicht in den DIN EN 136 Atemanschluss und DIN EN 443 Feuerwehrhelme enthaltene Forderungen
Ende November 2014 wurde die überarbeitete DIN 58610 „Atemschutzgeräte – Vollmasken verbunden mit Kopfschutz zum Gebrauch als ein Teil eines Atemschutzgerätes für die Feuerwehr – Anforderungen und Prüfungen“ herausgegeben. Diese Norm legt Mindestanforderungen und Prüfungen für diesen Atemanschluss zum Gebrauch mit Atemschutzgeräten und Feuerwehreinsatzbekleidung fest. Dieser Atemanschluss besteht aus einem Feuerwehrhelm und einer Vollmaske, die am Helm befestigt wird. Der Helm erfüllt die Aufgaben
- Kopfschutz
- Maskenbänderung.
Für das An- und Ablegen der Vollmaske bleibt dem atemschutzgeräteträger ein Absetzen des Feuerwehrhelmes erspart.
Maske und Helm lassen sich mit einstellbaren oder mit sich selbst einstellenden Verbindungselementen sicher koppeln. Dieser Atemanschluss wird auch als Masken-Helm-Kombination (HMK), (wwww.atemschutzlexikon,de/lexikon/Masken-Helm-Kombination), bezeichnet.
Zum sicheren Tragen der Masken-Helm-Kombination gehört, dass der Feuerwehrhelm vom Atemschutzgeräteträger selbst genau auf ihn passend einzustellen ist. Wenn er zu locker sitzen würde, wäre ein einwandfreier Dichtsitz des Atemanschlusses nicht zu erreichen. Der zu lockere Sitz des Feuerwehrhelmes könnte im Atemschutzeinsatz zu ungewollten Undichtigkeiten führen, z. B. durch einseitige Belastung der Vollmaske im Bereich der Stirn (wwww.atemschutzlexikon,de/Fortbildung/HandhabungAtemschutzgeräte).
Der Helm ist dafür vorgesehen, den Kopf des Gerätträgers zu schützen und gleichzeitig durch ein Verbindungssystem als Bänderung für eine Vollmaske zu dienen.
Der Helm der MHK entspricht den Forderungen der DIN EN 443, die Vollmaske der DIN EN 136. Die HMK ist zum Tragen bei Einsätzen der Feuerwehren, Katastrophenschutzorganisationen und im industriellen Atemschutz vorgesehen.
Übersicht der wesentlichen Inhalte:
- Anwendungsbereich
- normative Verweisungen
- Begriffe
- Beschreibung
- Anforderungen
- Allgemeines
- Aufbau
- Verbindungssystem
- Nach innen gerichtete Leckage
- Praktische Leistungsprüfung
- Zubehör (optional)
- Prüfung
- Allgemeines
- Sichtprüfung
- Nennwerte und Toleranzen
- Zugfestigkeit des Verbindungssystems
- Prüfung auf nach innen gerichtete Leckage: Probanden, Prüfablauf
- Praktische Leistungsprüfung: Allgemeines, Durchführung, Prüfbericht
- Kennzeichnung
- Informationsbroschüre des Herstellers Literaturhinweise
- Anlagen: Bilder Prüfkopf, Bestimmung Kopfumfang, Bestimmung Gesichtsbreite
Die Original-Norm können Sie unter folgender Adresse kaufen:
Beuth Verlag GmbH
Am DIN-Platz
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin