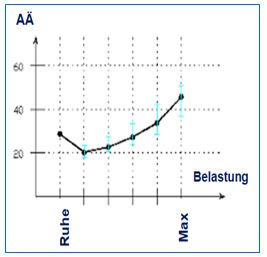Definition
Gefährdungen lassen sich in Gruppen zusammenfassen. Dazu steht die nachfolgende Systematik von Gefährdungs- und Belastungsfaktoren zur Verfügung.
Bildquelle: Dräger AG
Erläuterung
- 1. Mechanische Gefährdung
- 2. Elektrische Gefährdung
- 3. Gefahrstoffe
- 4. Biologische Arbeitsstoffe
- 5. Brand- und Explosionsgefährdungen
- 6. thermische Gefährdungen
- 7. Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen
- 8. Gefährdung durch Arbeitsumgebungsbedingungen
- 9. Physikalische Belastung/Arbeitsschwere
- 10. Psychische Belastung
- 11. Sonstige Gefährdung