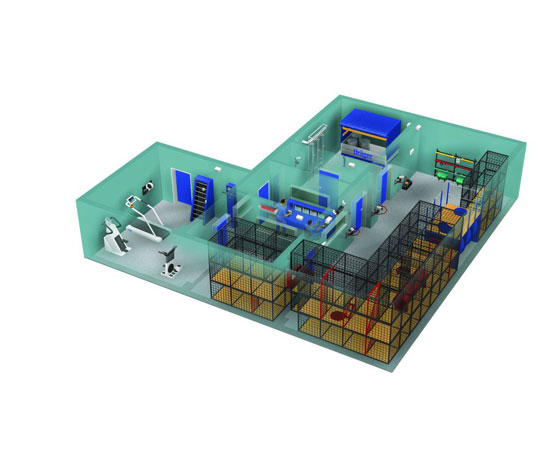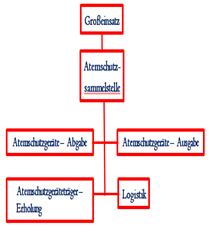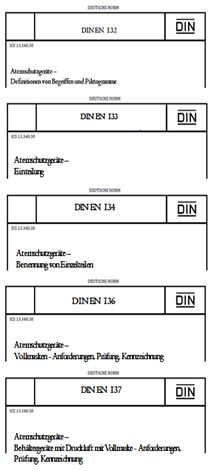Definition
ein gegenüber der Umgebungsluft unabhängig wirkendes Atemschutzgerät, nach DIN EN 133 auch Isoliergerät, das frei tragbar ist, einen Vorrat an Druckluft (Atemluft) besitzt und von der Umgebungsluft unabhängig ist. Das Behältergerät wird vom Atemschutzgeräteträger (ASGT) am Lungenautomat mit dem Atemanschluss des ASGT gasdicht verbunden.
Dem ASGT wird die Einatemluft aus am Gerät mitgeführten Druckluftflaschen zugeführt. Durch das Behältergerät wird der ASGT während einer vom Druckluftvorrat und der Belastung des ASGT abhängigen Zeitdauer vor dem Einatmen von Umgebungsluft geschützt.
Bildquelle: Dräger AG
Erläuterung
Der Atemluftvorrat wird je nach Gerätetyp in ein oder zwei Druckluftflaschen mit einem Fülldruck von 200 bzw. 300 bar gespeichert. Nach derzeitigem Stand lassen sich bis zu 3.740 Liter Atemluftvorrat mitführen, wenn zwei Druckluftflaschen mit je 6,8 Liter Volumen und 300 bar Fülldruck verwendet werden. Die Druckluftflasche wird am Druckminderer angeschraubt und mit der Rüttelsicherung gegen unbeabsichtigtes Lockern gesichert. Zum Befestigen von zwei Druckluftflaschen schraubt man ein T-Stück zwischen Druckminderer und Druckluftflaschen.