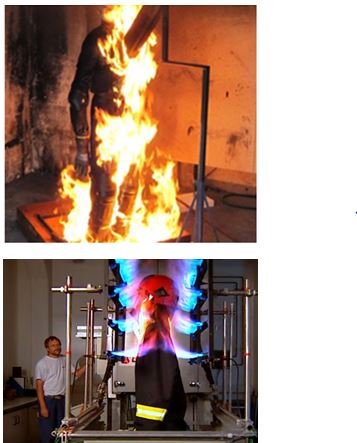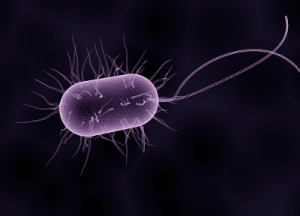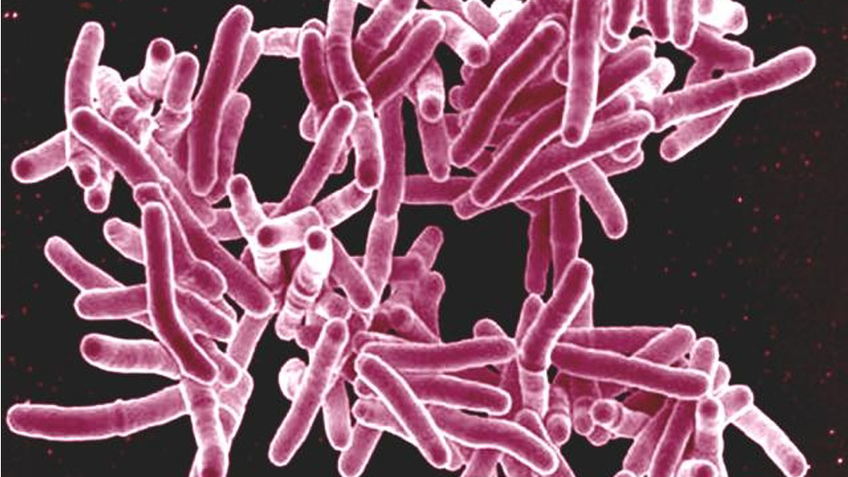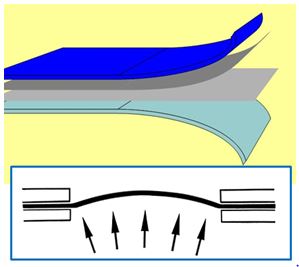
Definition
Kriterium für die mechanische Beständigkeit von Chemikalienschutzanzügen.
Einteilung in Klassen, Klasse 6 ist höchste und beste Klasse, Angaben in kPa.
Bildquelle: W. Gabler
Erläuterung
Die Berstfestigkeit wird definiert in:
- DIN EN 943 Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige
Chemikalien, einschließlich Flüssigkeitsaerosole und feste
Partikel Leistungsanforderungen für belüftete und unbelüftete
„gasdichte“ (Typ 1) und „nicht-gasdichte“ (Typ 2) Chemikalien-
schutzanzüge;
ISO 2960 Textilien – Bestimmung der Berstfestigkeit und voller Ausdehnung – Membran-Verfahren.