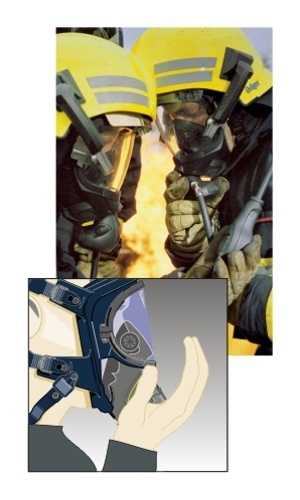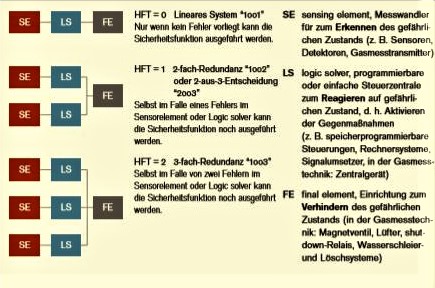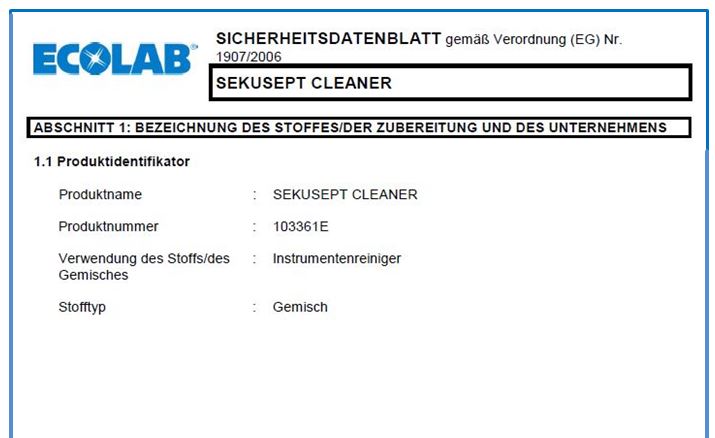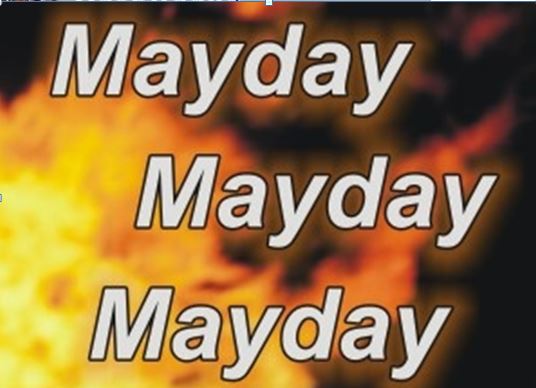Definition
Aufgabe der Sichtprüfung ist es nach Richtlinie vfdb 0804 „Wartung von Atemschutzgeräten für die Feuerwehren“ und der jeweiligen Bedienungsanleitung visuell zu prüfen, dass keine Sicherheitsmängel an einem Atemschutzgerät (ASG) bestehen
Bildquelle: Dräger AG
Erläuterung
Die Sichtprüfung der Atemschutzgeräte (ASG) ist eine vorgeschriebene Aufgabe des Atemschutzgerätewartes und umfasst die Prüfung des äußeren Zustandes des Atemschutzgerätes und des Zustandes jedes demontierten Geräteteiles auf Sauberkeit, Unversehrtheit und Vollzähligkeit. Der Atemschutzgerätewart beginnt damit die Prüfung eines Atemschutzgerätes. Form und Zustand der Tragevorrichtung und der einwandfreie äußere Zustand der luftführenden Teile werden erfasst. Bei Atemanschlüssen, z. B. Vollmasken, sind der Maskenkörper, die Sichtscheibe, die Kopfspinne (oder Helmadapter) und der Dichtrahmen zu prüfen.
Das Ergebnis dieser Prüfung muss der Atemschutzgerätewart in das Prüfprotokoll aufnehmen, wenn es der Hersteller vorschreibt (Bedienungsanleitung). Defekte Teile muss der Atemschutzgerätewart austauschen.