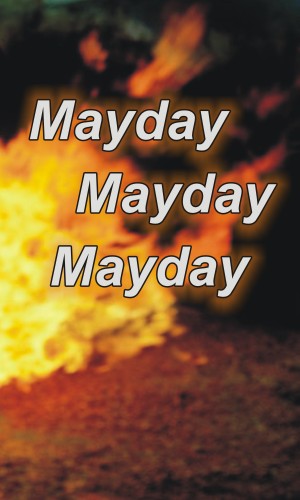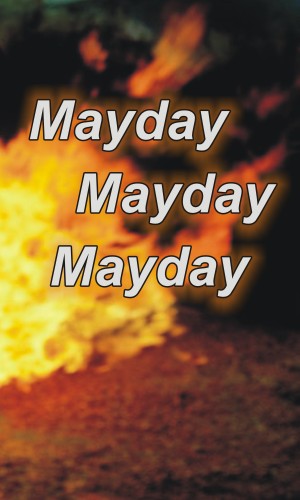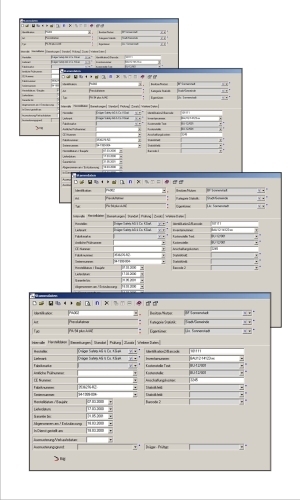Definition
Ausdauer ist die Fähigkeit, eine Belastung, z. B. durch das Tragen von Atemschutzgeräten, über eine möglichst lange Zeit ausüben zu können.
3 Kriterien bestimmen die Ausdauer:
- eine gegebene Belastung ohne nennenswerte
Ermüdungsanzeichen über einen möglichst langen
Zeitraum aushalten zu können; - trotz deutlich eintretender Ermüdungserscheinungen
eine sportliche Tätigkeit bis hin zur individuellen
Beanspruchungsgrenze fortsetzen zu können - sich in Zeiten verminderter Beanspruchung und
nach Abschluss der selben schnell regenerieren zu können.
Erläuterung
Die Verbesserung bzw. Bewahrung der Ausdauer (Ausdauertraining) ist ein zentrales Ziel, sowohl im Bereich der allgemeinen Fitness als auch im Interesse der Atemschutzgeräteträger (Ausbildung im Atemschutz).